Wenn ein Mensch inhaftiert wird, betrifft das nicht nur die verurteilte Person – auch ihre Angehörigen werden oft unsichtbar mitbestraft. Partner*innen, Kinder, Eltern oder enge Freund*innen geraten plötzlich in eine Ausnahmesituation. Sie erleben emotionale Belastungen, soziale Ausgrenzung und organisatorische Herausforderungen. Oft fehlen passende Anlaufstellen, Austauschmöglichkeiten oder schlicht das Gefühl, verstanden zu werden.
Um diese Menschen in den Fokus zu rücken und ihnen eine Stimme zu geben, hat der SKM Freiburg den Podcast „Mitbestraft – Im Gespräch mit Angehörigen von Inhaftierten“ ins Leben gerufen.
Die Idee entstand direkt aus einer Angehörigengruppe heraus – ein starkes Beispiel für gelebte Selbstvertretung und Empowerment. In jeder Folge sprechen Angehörige offen und ehrlich über ihre Erfahrungen: über Sprachlosigkeit, Schuldgefühle und Isolation – aber auch über Kraftquellen, Veränderung und Hoffnung. Der Podcast möchte Angehörige nicht nur emotional entlasten, sondern auch ermutigen, neue Wege im Umgang mit der belastenden Situation zu finden.
Ziel des Podcasts ist es, die oftmals übersehene Lebensrealität von Angehörigen inhaftierter Menschen sichtbar zu machen und ein Angebot zu schaffen, das niedrigschwellig zugänglich ist – auch für Betroffene, die sich (noch) nicht aktiv Hilfe holen können oder wollen. Darüber hinaus soll das Format öffentliche Aufmerksamkeit auf ein Tabuthema lenken, das bislang zu selten gesellschaftlich und politisch Beachtung findet. Nicht zuletzt richtet sich der Podcast auch an Fachkräfte, die im Arbeitsalltag mit betroffenen Familien in Berührung kommen – mit dem Ziel, sie zu sensibilisieren und zum Nachdenken anzuregen.
Was erwartet Sie im Podcast?
Jede Folge beleuchtet ein zentrales Thema aus dem Alltag Angehöriger – authentisch, sensibel und ehrlich.
Bereits erschienen sind:
Jeden Monat erscheint eine neue Folge.


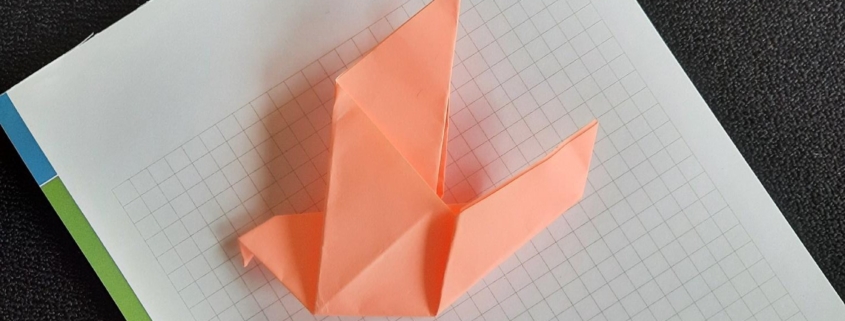




 Mit Glückskeksen, Broschüren und einem Lastenrad Gepäck baut er das Angehörigencafé vor der Justizvollzugsanstalt Nürnberg auf. „Am schönsten ist es, wenn es sich mischt und Angehörige mit Angestellten der Justiz ins Gespräch kommen. Dann entsteht Verständnis auf beiden Seiten.“
Mit Glückskeksen, Broschüren und einem Lastenrad Gepäck baut er das Angehörigencafé vor der Justizvollzugsanstalt Nürnberg auf. „Am schönsten ist es, wenn es sich mischt und Angehörige mit Angestellten der Justiz ins Gespräch kommen. Dann entsteht Verständnis auf beiden Seiten.“

